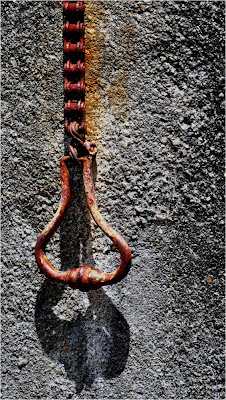Dass die „Weltstadt mit Herz“ im
Grunde genommen nichts anderes sei als ein großes Kuhdorf, diese Ansicht wird oft
und gern vertreten. Und das nicht nur hinter vorgehaltener Hand.
Seit dreißig Jahren lebe ich schon
hier, achtzehn davon in einem Stadtteil, der, so kann ich mit Fug und Recht
behaupten, besser ist als sein Ruf. Nicht nur, dass er über eine hervorragende
Infrastruktur verfügt, er besitzt auch etwas, das in weitaus nobleren Vierteln
eher Mangelware ist: nämlich Grün.
Vom elften Stockwerk aus ist dies
besonders augenfällig: der Blick fällt nicht etwa in die Tiefe, sondern taucht
ein in ein Meer aus vielschichtigem Grün. Die Bäume sind mittlerweile so hoch,
dass die Betonfluchten darin wie Inseln scheinen, von denen nur der jeweils höchste
Punkt noch sichtbar ist. Darüber hinweg fliegt das Auge bis zum Waldesrand und
bleibt schließlich am Saum der Alpen unwiderruflich hängen. An Tagen, an denen
der Föhn sein Spiel mit Wolken und
kopfwehgeplagten Einwohnern auf die Spitze treibt, ist jede einzelne davon zu
erkennen: ein wildgezacktes Band, durchschnitten von dunkelgeahnten Tälern.
Auf meinem Weg zur U-Bahn, die mich
in weniger als einer Viertelstunde wieder ausspuckt mitten in der Stadt, gehe
ich aber täglich an einem ganz anderen Wunder vorbei. Zwischen drei, zu
Stoßzeiten relativ befahrenen Straßen und einem großen kastanienbepflanzten
Platz, auf den sich vereinzelt Robinien eingeschlichen haben und der wochentags
als Parkplatz dient, liegt ein Stück Land, das offenbar niemandem gehört. Was
natürlich nicht sein kann, denke ich mir, weil doch immer alles irgendwem
gehört. Ich hab mich bisher nicht getraut, dem nachzuforschen, vielleicht aus
Angst, dass sich vielleicht Besitzansprüche schneller klären, als mir das lieb
wäre. Man weiß ja nie, in welches Wespennest man gerade sticht. Es handelt sich
um eine Wiese, die erst zum Sommerende wenn überhaupt gemäht wird. Nie ist es
mir gelungen, den Zeitpunkt zu erwischen, da sich dort jemand den Mühen dieser
Arbeit unterzieht. So oft ich auch darauf geachtet habe: an einem Tag ist sie
noch da, am nächsten – weg.
Wenn nach langen Wintertagen und
feuchtem Schmuddelwetter der Boden langsam sich begrünt, ist es an der Zeit für
mich, hier offeneren Auges vorbei zu gehen. Den Schritt zu zügeln. Die Luft
bewusster einzuatmen. Um wahrzunehmen, wie früh oder wie spät es tatsächlich
ist im Jahr.
Zwischen hellgrünen Gräsern
schimmert als erster vereinzelt Huflattich, dicht gefolgt von Hahnenfuß und
Wiesenveilchen. Und wenn die Sonne gnädig ist, verwandeln bald schon Löwenzahn
und Margeriten, Taubnesseln und Glockenblumen das Stückchen Land in einen
buntbestickten Teppich, an dessen Rand, zur großen Straße hin, Holunderbüsche
auf ihren Einsatz warten. Dazwischen ranken Heckenrosen mit ihren filigranen
Blüten. Es flügelt und flattert, summt und brummt, hörbar durchaus. Im
Wettstreit mit Motorenlärm, der sich hier wie durch ein Wunder noch in annehmbaren
Grenzen hält.
Jetzt, im Juli, nach reichlich Regen
und ein paar sengendheißen Tagen, wuchern wilde Möhre, Schafgarbe und
Rosenmalve. Hüfthoch stehn die Gräser, wogend im leichten Wind, der Klee wird
schier erdrückt. Und wenn nach einem Schauer der Boden dampft, liegt dieser
unverwechselbare Duft von Sommer in der Luft, von Kindheit und von einem fernen
Garten, den es lang schon nicht mehr gibt.
Wie groß mag sie denn sein, die
wilde Wiese? Ich weiß es nicht, ich war schon immer schlecht im Schätzen.
Jedenfalls scheint sie mir groß genug, um irgendwann bebaut zu werden mit einem
unnütz Ding. Doch Jahr für Jahr vergeht und nichts geschieht. Sie lebt und
blüht und wuchert. Vielleicht auch nur für mich.
In diesem Kuhdorf, meinem München.
/c/ Monika Kafka, 08/12